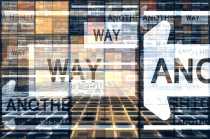Missing Link: Karten-Pionier Schweden entdeckt die Bedeutung von Bargeld neu

Cash ist King – aber wie lange noch?
(Bild: AlAnton/Shutterstock.com)
Die schwedische Riksbank betont plötzlich die unverzichtbare Rolle von Bargeld für sichere, allgemein verfügbare Zahlungssysteme. Das ist ein Strategiewechsel.
"Schweden schafft das Bargeld ab" oder "Die erste bargeldlose Gesellschaft der Welt entsteht". Mit solchen Schlagzeilen machten deutsche Zeitungen vor gut zehn Jahren auf. 2013 etwa sorgte vor allem das große schwedische Finanzinstitut Swedbank für Aufsehen, weil es auch in seiner traditionellen Filiale an der Einkaufsstraße Östermalmstorg kein Bargeld mehr ausgeben oder annehmen wollte – in einem Stadtteil, in dem über ein Viertel der Bevölkerung über 60 Jahre alt sind. Diese Klientel hatte damals – wie heute – noch das größte Faible für Bargeld, sodass die Ankündigung auch Symbolwirkung hatte.
Immer mehr schwedische Banken stellten zu diesem Zeitpunkt den Bargelddienst in den Filialen ein. Sie setzten zunächst voll auf Kreditkarten, die Transaktionen komplett nachvollziehbar machen. Doch Experten warnen vor einer "Welt ohne Bargeld" [2]. Gegenüber unbaren Zahlungsmitteln bilde Cash ein wichtiges Korrektiv im Zahlungsverkehr mahnt etwa das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB). Keine Karte und schon gar virtuelle "Münzen" wie Bitcoin erreichten "ein ähnlich hohes Inklusionsniveau" oder einen vergleichbaren Schutz der Privatsphäre. Zudem vergrößere sich durch viele digitale Zahlungsvarianten der Einfluss von Big-Tech-Konzernen aus den USA und China auf das Finanzwesen.
Seit etwa 2020 deutet sich auch bei Bargeldlos-Pionier Schweden eine Kehrtwende an. Die dortige Politik denkt über die Notwendigkeit gesetzlicher Standards für eine Grundversorgung mit Bargeld nach. Die Regierung in Stockholm trieb schließlich nicht nur ihr Projekt zur "E-Krona" [3] voran. Parallel brachte sie ein Gesetz auf den Weg, mit dem das Niveau der Bargeldversorgung des Jahres 2017 wiederhergestellt und gewährleistet werden soll.
Kurskorrektur der Zentralbank
Auch die schwedische Zentralbank, die Riksbank, hat jetzt im großen Stil die Kehrtwende eingeläutet: Sie betont in ihrem Jahresbericht 2024 [4] die unverzichtbare Rolle von Bargeld für sichere und allgemein verfügbare Zahlungssysteme. Als großes Sicherheitsdefizit sieht die Nationalbank die Funktionsfähigkeit des digitalen Zahlungsverkehrs bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Stromausfällen oder auch in kritischen Situationen wie im Falle einer Cyberattacke.
Mit den bestehenden digitalen Zahlungssystemen könne die notwendige Stabilität und Resilienz nicht gewährleistet werden, schlägt die Riksbank Alarm. Daher müssten sowohl der öffentliche als auch der private Sektor die Nutzbarkeit von Bargeld sicherstellen und eine entsprechende Infrastruktur für die Geldversorgung aufrechterhalten. Denn die Zahlungsmittel seien nicht für alle Bevölkerungsgruppen jederzeit zugänglich und verfügbar.
"Das Zahlungssystem muss stabil und widerstandsfähig gegenüber Störungen in normalen Zeiten sein", betont das 1668 vom schwedischen Staat gegründete Finanzhaus. Es müsse aber auch in Krisenzeiten und bei erhöhter Alarmbereitschaft funktionsfähig sein. Es sollte daher möglich sein, mehrere Zahlungsmethoden zu verwenden. Entscheidend sei, Zahlungen auch dann durchführen zu können, "wenn es zu einer Störung in irgendeinem Teil des Zahlungssystems kommt".
Rasante Digitalisierung hat auch Nachteile
"Der schwedische Zahlungsmarkt wurde rasant digitalisiert", konstatiert die Riksbank. Bargeld und manuelle Zahlungsdienste seien durch Karten, Mobiltelefone und Internetdienste ersetzt worden. "Dadurch sind Zahlungen insgesamt schneller, reibungsloser und günstiger geworden", verweist das Institut auf "eine positive Entwicklung". Es gebe jedoch Gruppen in der Gesellschaft, "die keinen Zugang zu digitalen Zahlungsdiensten haben oder diese nur schwer nutzen können und daher marginalisiert werden". Ferner bestünden "schwerwiegende Betrugsprobleme, die das Vertrauen in das Zahlungssystem untergraben könnten".
Die Digitalisierung mache Zahlungen "auch anfälliger für Cyberangriffe und Störungen des Stromnetzes und der Datenkommunikation", gibt die Bank zu bedenken. Gleichzeitig erforderten die geopolitischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, "dass Schweden über einen starken Zivilschutz verfügt". Die Entwicklungen legten nahe, "dass wir uns stärker als bisher auf die Herausforderungen der Digitalisierung konzentrieren sollten".
Die Riksbank selbst steuere bereits gegen. Durch die Einrichtung neuer Büros, in denen Unternehmen Bargeld abholen und einzahlen können, verbessere sie die Bargeldversorgung. Wenn solche Cash-Depots an mehr Standorten im ganzen Land vorhanden wären, verringerten sich sowohl die Kosten für Unternehmen als auch das Risiko, dass Bargeld im Falle einer Störung kaum mehr verwendet werden könne.
Zentralbank sieht die Politik gefragt
An die Regierung und den Reichstag appelliert das Institut, neue Gesetze zur Bargeldverwaltung einzuführen: "Als allgemeine Regel müssen Händler, die lebenswichtige Güter verkaufen, zur Annahme von Bargeld verpflichtet werden". Nur so sei zu gewährleisten, "dass jeder bezahlen kann". Generell sei ein "stärkerer Rechtsschutz für Bargeld" nötig. Banken sollten verpflichtet werden, "Bargeldeinlagen, einschließlich Münzen, von Privatpersonen anzunehmen".
Ihre Forderungen untermauert die Riksbank mit dem Verweis auf eine jährlich durchgeführte repräsentative Umfrage zu den Zahlungsgewohnheiten der Schweden. Demnach werde "Bargeld häufiger als zuvor verwendet". Fast die Hälfte der Befragten hat angegeben, im vergangenen Monat Bargeld genutzt zu haben, was einem Anstieg von 15 Prozentpunkten gegenüber 2022 entspricht.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung [5].
Zugleich zeigen andere Daten, dass die Bargeldnutzung eher weiter zurückgegangen ist. Das entspreche auch dem Trend aus mehreren Jahren, so die Riksbank. So sei 2023 erneut weniger an Geldautomaten abgehoben worden, der Bargeldumlauf insgesamt um 10 Prozent gesunken. Eine mögliche Erklärung für die angegebene erhöhte Nutzung von Bargeld könnte sein, dass Privatpersonen Reserven angezapft haben, "nachdem Russland im Jahr 2022 seine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete".
Parallel entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, statt einer physischen Bezahlkarte ihr Mobiltelefon mit Diensten wie Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay einzusetzen. In der Riksbank-Umfrage 2023 gaben 63 Prozent an, bei ihrem letzten Einkauf im Geschäft eine Debitkarte gezückt zu haben. Das sind 10 Prozentpunkte weniger als 2022. Gleichzeitig erklärten 9 Prozent, mit ihrem Smartphone gezahlt zu haben, fast doppelt so viel wie 2022. Als wichtigsten Grund dafür nannten sie, dass dieser Mechanismus "einfach und bequem" sei.
Schweden sehen Schwinden des Bargelds zunehmend negativ

(Bild: peterschreiber.media/Shutterstock.com)
Zugleich halten den Ergebnissen zufolge aber auch immer mehr Schweden den Rückgang des Bargeldverbrauchs für eine negative Entwicklung – 44 Prozent im Jahr 2023 im Vergleich zu 36 Prozent im Vorjahr. Auch der Anteil der Befragten, die meinen, dass sie in der heutigen Gesellschaft nicht ohne Bargeld auskämen, ist gestiegen im Vergleich zu 2022. Dies könnte ebenfalls "ein Effekt des erhöhten Krisenbewusstseins aufgrund des Krieges in der Ukraine sein", mutmaßen die Banker.
Genannt werde auch die Notwendigkeit, in bestimmten Situationen wie bei Vereinen, in Tante-Emma-Läden und auf Flohmärkten bar zu bezahlen, heißt es weiter. Manche betonten zudem, dass es ihnen durch die Nutzung von Bargeld eher gelinge, den Überblick über ihre Finanzen zu behalten. Älteren Menschen falle es generell deutlich schwerer, ohne Bargeld auszukommen als jüngeren. In der Umfrage 2023 gab die Hälfte der Befragten an, dass sie bar zahlen wollten, das Geschäft dies jedoch nicht akzeptiert habe. 2022 lag der entsprechende Wert erst bei 37 Prozent.
Ein oft zu hörendes Argument dafür, Bargeld auszusortieren, ist der Kampf gegen Kriminalität. Die Logik: Wo es kein Cash mehr gibt, finden auch keine Banküberfälle oder Sprengungen von Geldautomaten mehr statt, wird Geldwäsche erschwert. Sämtliche Zahlungstransaktionen würden der Anonymität entrissen, was kriminelle Aktivitäten erschwere. Der österreichische Ökonom Friedrich Schneider etwa rechnete bereits vor, dass die Schattenwirtschaft um 15 Prozent schrumpfen könnte ohne Bargeld. Ferner ließen sich Einkünfte so besser kontrolliern und besteuern.
"Bedroht die Selbstbestimmung aller Bürger"
Aber es gibt ja nicht nur die Bedürfnisse des Staates. Die Abschaffung von Bargeld "bedroht die informationelle Selbstbestimmung aller Bürger und ist damit politisch hochexplosiv", halten Urban Bacher, Professor für Bankmanagement, und Hanno Beck, Professor für Wirtschaftspolitik, von der Hochschule Pforzheim dagegen [6]: "Es geht um Grundfreiheiten, um die Freiheit sich zu informieren, zu bewegen und auszutauschen, ohne Angst haben zu müssen, überwacht zu werden." Ob die mit der Idee der Abschaffung des Bargelds verbundenen Ziele potenziell massive Eingriffe in die Grundrechte rechtfertigen, sei zumindest "diskussionswürdig".
"Der Kampf gegen die kriminelle Wirtschaft ist sehr wichtig", schreibt die Riksbank dazu. Sie ist jedoch der Ansicht, "dass dies nicht dazu führen sollte, dass Geschäfte und andere Unternehmen kein Bargeld mehr annehmen". Solange Verbraucher und Unternehmen Cash benötigten und nutzen wollten, sollten sie dazu in der Lage sein. Betragsbegrenzungen können eine Möglichkeit sein, weiterhin die Möglichkeit der Barzahlung zu bieten und gleichzeitig Verbrechern Steine in den Weg zu legen.
Die EU verfolgt diesen Ansatz konsequent: Unterhändler des Parlaments, des Ministerrats und der Kommission einigten sich im Januar auf ein weiteres Gesetzespaket im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung [7]. Barzahlungen über 10.000 Euro werden damit in der gesamten EU verboten. Die Mitgliedstaaten erhalten die Option, niedrigere Schwellenwerte festzulegen. Zuständige wie Banken oder Händler müssen ferner die Identität einer Person feststellen und überprüfen, sobald es um Bargeldtransaktionen zwischen 3000 und 10.000 Euro geht. Anonyme Zahlungen sind also nur noch bis 2999 Euro möglich.
Umstrittene Registrierkassen und Bons
Die Riksbank befürwortet zugleich den Vorschlag der nationalen Zahlungsverkehrsbehörde, dass es möglich sein sollte, Ausnahmen von der Anforderung zur Nutzung von digitalen Registrierkassen in Krisenzeiten oder bei erhöhter Alarmbereitschaft zu machen. Dies würde die Option erhöhen, in solchen Situationen bar zu bezahlen. Nach geltender Gesetzgebung müssen Händler in Schweden – ähnlich wie in Deutschland [8] – in der Lage sein, alle Einkäufe in einer Registrierkasse zu erfassen und dem Kunden eine Quittung auszustellen. Das bedeutet, dass sie kein Bargeld annehmen können, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, wenn ihr Kassensystem nicht funktioniert.
Weitere Maßnahmen zum Schutz von Bargeld hält die Zentralbank ebenfalls für unerlässlich. Der Staat müsse "die grundlegende Infrastruktur für Bargeld aufrechterhalten", sonst bestehe "die Gefahr, dass Bargeld als Zahlungsmittel in naher Zukunft nahezu unbrauchbar wird". Das neue Gesetz für die Riksbank, das Anfang 2023 in Kraft trat, gibt der Zentral bereits eine klarere und teilweise erweiterte Verantwortung für die Bargeldinfrastruktur in Schweden. Sie muss mindestens fünf über das Land verteilte Banknotendepots betreiben.
Bar- und Digitalgeld als Ergänzung
Mittlerweile hat der schwedische Gesetzgeber auch einige andere Banken verpflichtet, Bargeldstellen anzubieten, an denen Unternehmen und Vereine im ganzen Land ihre täglichen Einnahmen einzahlen können. Sie erfüllen diese Verpflichtung hauptsächlich über die Firma Bankomat AB. Die Riksbank wertet das als Fortschritt. Dieser reiche jedoch nicht, um sicherzustellen, dass Bargeld jederzeit verwendet werden könne.
Für den Münchner Finanzdienstleister Giesecke+Devrient (G+D) liefert der Bericht der Schweden auch gute Gründe für die Einführung einer zu Bargeld komplementären digitalen Zentralbankwährung, die die Vorteile von Scheinen und Münzen in der digitalen Welt abbildet. Die Riksbank arbeite weiter an der E-Krone als sogenannte Central Bank Digital Currency (CBDC) für Schweden. Im Euro-Raum treibt die Europäische Zentralbank (EZB) die Entwicklung des digitalen Euro voran [9].
Digitale Zentralbankwährungen gewährleisten bei einer eingeschlossenen Offline-Komponente laut G+D auch die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit bei ausfallender Strom- oder Internetversorgung. Sie bildeten daher ein "gleichwertiges Pendant zu Bargeld". G+D-Chef Wolfram Seidemann begrüßt so das Statement aus Schweden: "Die schwedische Zentralbank hat erkannt, dass physisches Bargeld nach wie vor unverzichtbar ist. Wirtschaft und Gesellschaft brauchen die Koexistenz analoger und digitaler Zahlungsmittel, die sich gegenseitig ergänzen."
(vbr [10])
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-9708325
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/thema/Missing-Link
[2] https://www.heise.de/news/Bundestag-Gutachter-warnen-vor-Welt-ohne-Bargeld-7167699.html
[3] https://www.heise.de/hintergrund/Kryptowaehrung-von-Staats-wegen-4046931.html
[4] https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/betalningsrapport/2024/engelsk/payments-report-2024.pdf
[5] https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html
[6] https://www.kreditwesen.de/kreditwesen/themenschwerpunkte/aufsaetze/bargeld-lacht-bargeld-abschaffen-id30353.html
[7] https://www.heise.de/news/EU-Gremien-einig-Anonyme-Barzahlungen-nur-noch-bis-2999-Euro-9601949.html
[8] https://www.heise.de/news/Anti-Steuerbetrug-BSI-zertifiziert-erste-Sicherheitsmodule-fuer-Kassensysteme-4621719.html
[9] https://www.heise.de/news/EZB-will-weiter-am-digitalen-Euro-arbeiten-9338078.html
[10] mailto:vbr@heise.de
Copyright © 2024 Heise Medien